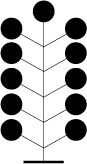STIMMEN
Welche Bedeutung hat die Gemeindefusion für die Menschen an diesem Ort, der als älteste Walserkolonie im Kanton Graubünden gilt? Und welche Potenziale birgt sie für eine aus heutiger Sicht angeblich potenzialarme Region? Gibt es für die Gemeinde Rheinwald eine andere Zukunft als diejenige einer Alpinen Brache? Welche Beschäftigungen sind für ihre Bevölkerung denkbar, wenn der Klimawandel für diese Region wichtige wirtschaftliche Bereiche wie Tourismus und Landwirtschaft vor einen Umbruch stellt? Und wäre eine Existenz in Rheinwald ohne Agrarsubventionen möglich?


Ausgehend von der Hypothese der gemeindeweiten Genossenschaft, die alle Lebensbereiche von Rheinwald umfasst, werden solche Ansätze mit den Bürgerinnen und Bürgern diskutiert und Meinungen über neue Möglichkeiten in der Landwirtschaft, im Tourismus und im übrigen lokalen Arbeitsmarkt gesammelt und ausgewertet.
In diesem Film wird einer Auswahl von lokalen Akteuren die Idee der Talgenossenschaft vorgelegt. Eine Konfrontation mit einem provokanten Gedanken, der diesen Menschen aber eine Stimme geben soll, und sie, wie sich gezeigt hat, sogar zum Erzählen bringt. Wie sehen sie die Zukunft ihres Wohnortes? Was halten sie von Direktzahlungen, die Randregionen in den Alpen klar begünstigen, aber auch abhängig machen? Verschiedene Haltungen werden in einer Sammlung von Interviews porträtiert, mit dem Ziel ein Bild von Rheinwald wiederzugeben, welches einen tieferen Einblick in die lokalen Lebens- und Wirtschaftsweisen ermöglicht.


Jürg Flükiger, Käser der genossenschaftlichen Sennerei in Splügen
Da wäre der einzige Bäcker im Tal, der nach Jahren im Ausland wieder an seinen Heimatort zurückkehrte und nun nüchtern der Zukunft seines Unternehmens und Handwerkes entgegenschaut. Oder der Milchbauer, der als Direktzahlungsempfänger die Erhaltung der heutigen Agrarpolitik der Erhaltung der Talschaft gleichstellt. Die Touristikerin, die als Zugezogene auf Jahrzehnte lange Überzeugungsarbeit und die Suche nach neuen Ideen zurückblickt, und die lokale Bevölkerung nun besser kennt, als so mache einheimische Person. Weiter der Hotelier, der in seinem fast pausenlosen Beruf nicht zuletzt eine Vermittlerrolle zwischen den lokalen und auswärtigen Gästen sieht und so den Stellenwert seines Gasthauses für den Ort nur betonen kann. Oder der Käser, der in seinem traditionsreichen Handwerk und in kleinteiligen genossenschaftlichen Organisationen eine mögliche Zukunft für nachhaltige Lebensweisen in Rheinwald sieht. Und zuletzt ist da noch ein junger Student, der dank einer Pandemie von zuhause aus studieren kann, und nun einen Schimmer Hoffnung in der Digitalisierung sieht. Die Hoffnung darauf, in seinem Heimatort zu wohnen und dennoch als Ingenieur an überregionalen Projekten arbeiten zu können.


Denise Dillier, Touristikerin aus Splügen


Martin Winker, Bäcker in Splügen
Alles in allem sind die gesammelten Stimmen ernüchternd, denn logischerweise kann keine die Zukunft voraussagen. Auch zweifelt jede Haltung mehr oder weniger am Erfolg eines gemeindeumfassenden Gemeinschaftsgedankens, geschweige denn an der Umsetzbarkeit der Idee auf unternehmerischer und menschlicher Ebene. Die verschiedenen Haltungen im Film mögen nur einen Bruchteil aller Stimmen in Rheinwald repräsentieren. Sie sind aber der Beweis für die Schwierigkeit, allen gerecht zu werden, wo doch jede und jeder seine berechtigten und unterschiedlichen Interessen hat.


Willibald Löschl, Hotelier in Splügen


Christian Meuli, Milchbauer in Nufenen
Dennoch haben alle Stimmen etwas entscheidendes gemeinsam. Nämlich, dass man dankbar dafür ist, an einem Ort mit derart hoher Lebensqualität wohnen zu können. Dies mag vielleicht naiv klingen, es ist aber ein grundlegender Punkt. Denn er ist verbunden mit einer gemeinsamen Haltung, einer gemeinschaftlichen Motivation dafür, das Tal auch weiterhin bewohnbar, bewohnt und belebt zu erhalten und mit Entschiedenheit einer kulturellen und ökonomischen Verbrachung von Rheinwald entgegenzuwirken.


Andrea Meuli, Schreiner und Student aus Nufenen


STIMMEN
Welche Bedeutung hat die Gemeindefusion für die Menschen an diesem Ort, der als älteste Walserkolonie im Kanton Graubünden gilt? Und welche Potenziale birgt sie für eine aus heutiger Sicht angeblich potenzialarme Region? Gibt es für die Gemeinde Rheinwald eine andere Zukunft als diejenige einer Alpinen Brache? Welche Beschäftigungen sind für ihre Bevölkerung denkbar, wenn der Klimawandel für diese Region wichtige wirtschaftliche Bereiche wie Tourismus und Landwirtschaft vor einen Umbruch stellt? Und wäre eine Existenz in Rheinwald ohne Agrarsubventionen möglich?


Ausgehend von der Hypothese der gemeindeweiten Genossenschaft, die alle Lebensbereiche von Rheinwald umfasst, werden solche Ansätze mit den Bürgerinnen und Bürgern diskutiert und Meinungen über neue Möglichkeiten in der Landwirtschaft, im Tourismus und im übrigen lokalen Arbeitsmarkt gesammelt und ausgewertet.
In diesem Film wird einer Auswahl von lokalen Akteuren die Idee der Talgenossenschaft vorgelegt. Eine Konfrontation mit einem provokanten Gedanken, der diesen Menschen aber eine Stimme geben soll, und sie, wie sich gezeigt hat, sogar zum Erzählen bringt. Wie sehen sie die Zukunft ihres Wohnortes? Was halten sie von Direktzahlungen, die Randregionen in den Alpen klar begünstigen, aber auch abhängig machen? Verschiedene Haltungen werden in einer Sammlung von Interviews porträtiert, mit dem Ziel ein Bild von Rheinwald wiederzugeben, welches einen tieferen Einblick in die lokalen Lebens- und Wirtschaftsweisen ermöglicht.


Jürg Flükiger, Käser der genossenschaftlichen Sennerei in Splügen
Da wäre der einzige Bäcker im Tal, der nach Jahren im Ausland wieder an seinen Heimatort zurückkehrte und nun nüchtern der Zukunft seines Unternehmens und Handwerkes entgegenschaut. Oder der Milchbauer, der als Direktzahlungsempfänger die Erhaltung der heutigen Agrarpolitik der Erhaltung der Talschaft gleichstellt. Die Touristikerin, die als Zugezogene auf Jahrzehnte lange Überzeugungsarbeit und die Suche nach neuen Ideen zurückblickt, und die lokale Bevölkerung nun besser kennt, als so mache einheimische Person. Weiter der Hotelier, der in seinem fast pausenlosen Beruf nicht zuletzt eine Vermittlerrolle zwischen den lokalen und auswärtigen Gästen sieht und so den Stellenwert seines Gasthauses für den Ort nur betonen kann. Oder der Käser, der in seinem traditionsreichen Handwerk und in kleinteiligen genossenschaftlichen Organisationen eine mögliche Zukunft für nachhaltige Lebensweisen in Rheinwald sieht. Und zuletzt ist da noch ein junger Student, der dank einer Pandemie von zuhause aus studieren kann, und nun einen Schimmer Hoffnung in der Digitalisierung sieht. Die Hoffnung darauf, in seinem Heimatort zu wohnen und dennoch als Ingenieur an überregionalen Projekten arbeiten zu können.


Denise Dillier, Touristikerin aus Splügen


Martin Winker, Bäcker in Splügen
Alles in allem sind die gesammelten Stimmen ernüchternd, denn logischerweise kann keine die Zukunft voraussagen. Auch zweifelt jede Haltung mehr oder weniger am Erfolg eines gemeindeumfassenden Gemeinschaftsgedankens, geschweige denn an der Umsetzbarkeit der Idee auf unternehmerischer und menschlicher Ebene. Die verschiedenen Haltungen im Film mögen nur einen Bruchteil aller Stimmen in Rheinwald repräsentieren. Sie sind aber der Beweis für die Schwierigkeit, allen gerecht zu werden, wo doch jede und jeder seine berechtigten und unterschiedlichen Interessen hat.


Willibald Löschl, Hotelier in Splügen


Christian Meuli, Milchbauer in Nufenen
Dennoch haben alle Stimmen etwas entscheidendes gemeinsam. Nämlich, dass man dankbar dafür ist, an einem Ort mit derart hoher Lebensqualität wohnen zu können. Dies mag vielleicht naiv klingen, es ist aber ein grundlegender Punkt. Denn er ist verbunden mit einer gemeinsamen Haltung, einer gemeinschaftlichen Motivation dafür, das Tal auch weiterhin bewohnbar, bewohnt und belebt zu erhalten und mit Entschiedenheit einer kulturellen und ökonomischen Verbrachung von Rheinwald entgegenzuwirken.


Andrea Meuli, Schreiner und Student aus Nufenen